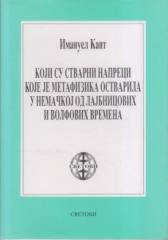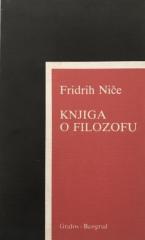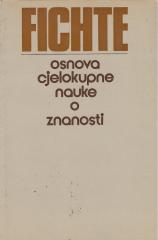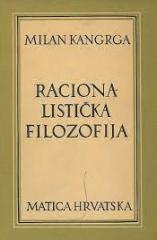Istorija ludila u doba klasicizma
Michel Foucaults „Die Geschichte des Wahnsinns im Zeitalter der Klassik“, erschienen 1961 (Originaltitel: Folie et Déraison), ist eine revolutionäre Analyse darüber, wie Westeuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Wahnsinn konstruierte un
Foucault, geboren 1926 in Poitiers, französischer Philosoph und Historiker der Macht (gestorben 1984), stellt hier die „Archäologie des Wissens“ vor: Wahnsinn ist keine angeborene Krankheit, sondern ein diskursives Produkt sozialer Normen, in denen die Vernunft das „Nicht-Vernunft“ als das Andere definiert und es der Kontrolle unterwirft.
Das in vier Teile gegliederte Buch zeichnet die Entwicklung nach: Im Mittelalter sind Geisteskranke in Leprakolonien sichtbar, die an die christliche Gnade erinnern; die Renaissance feiert sie als Propheten kosmischer Wahrheiten, symbolisiert durch frei segelnde „Schiffe der Geisteskranken“; die Antike (17. und 18. Jahrhundert) bringt die „Große Einsperrung“ – die Unterbringung in allgemeinen Krankenhäusern mit Bettlern und Prostituierten unter dem rationalen Regime Descartes’, wo Wahnsinn zur moralischen Strafe für wirtschaftliche Ineffizienz wird. In der Moderne, klassifiziert unter der Psychiatrie, verliert der Wahnsinn seine Stimme: Eingesperrt in Anstalten unter ärztlicher Aufsicht, ohne Dialog mit der Vernunft, wird er zu einer „Geisteskrankheit“.
Foucault entlarvt die Machtmechanismen: Wahnsinn als Spiegel der Vernunft, aber auch als Kritik am Mythos des Fortschritts der Aufklärung. Zitat: „Wahnsinn und Nicht-Wahnsinn, Vernunft und Nicht-Vernunft sind hier verworren miteinander verflochten: untrennbar von dem Moment an, in dem sie noch nicht existieren, und füreinander existierend.“
Dies beeinflusste sein späteres Werk (Überwachen und Strafen), inspirierte Deleuze und Guattari in Anti-Ödipus und Kritiken an Institutionen (wie Szasz’ Mythos der Geisteskrankheit). Kritikpunkte: Merquior wirft ihm sachliche Fehler und selektives Zitieren christlicher Grausamkeiten gegenüber Geisteskranken vor; Gutting bemerkt die Polarisierung – gelobt für analytische Gründlichkeit (Porter), aber kritisiert für die Vernachlässigung der Empirie. Das Buch ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung für das Verständnis, wie Macht die Subjektivität prägt.
Angeboten wird ein Exemplar